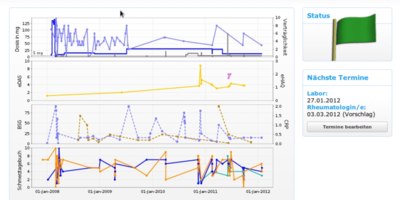120. Internistenkongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e. V. (DGIM)
Akademische Wissenschaft und Industrie als Partner? Internisten sehen Nachholbedarf bei Translationsforschung.

Wiesbaden – Viele Ideen für neue Medikamente kommen in den USA aus den Universitäten, die Entwicklung erfolgt in der Industrie. Nicht selten werden dort Forscher zu Gründern neuer Unternehmen, die Medizinprodukte herstellen.
In Deutschland dagegen ist die Zusammenarbeit von akademischer Medizin und Industrie im Sinne der Translationsforschung noch immer schwach ausgeprägt, mahnt die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM). Die DGIM sieht hier trotz vielversprechender Ansätze deutlichen Nachholbedarf. „Forschung wird zu Medizin“ heißt auch das Leitthema des 120. Internistenkongresses, der vom 26. bis 29. April in Wiesbaden stattfindet.
Medizinische Universitäten sind für den Vorsitzenden der DGIM, Professor Dr. med. Michael P. Manns aus Hannover, der ideale Ort für die Erforschung von Krankheitsursachen und -mechanismen. Mitunter ergeben sich daraus neue Therapieansätze.
„Präklinisch sollten diese Ideen sinnvollerweise auch von den Ärzten weiterentwickelt werden, die sie entdeckt haben“, meint der Direktor der Klinik für Innere Medizin an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).
In den USA gebe es dafür Start-up-Unternehmen, die die Entwicklung neuer Medikamente bis zu einem gewissen Grad vorantreiben. Danach würden die Patente häufig der Industrie übertragen. Denn nur die großen Firmen verfügen über die finanziellen Ressourcen, die für die klinische Prüfung von neuen Medikamenten und Medizinprodukten notwendig sind. „Einige erfolgreiche große Unternehmen erzielen bereits ihr gesamtes Wachstum aus den Arbeitsgebieten der übernommenen Start-up-Unternehmen“, berichtet Professor Manns.
In Deutschland kommen jährlich etwa 20 bis 40 neue Wirkstoffe auf den Markt. Auch hierzulande gibt es Ansätze, die Translationsforschung zu stärken: Interdisziplinäre Zentren für Klinische Forschung etwa, Kompetenznetze in der Medizin und die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) für die großen Volkskrankheiten.
Auf dem 120. Internistenkongress werden einige dieser translationalen Forschungsverbünde Paten ausgewählter klinischer Symposien sein. Sie stellen dort ihre Ziele und Ergebnisse anhand praktischer Beispiele vor, die direkten Einfluss auf die tägliche Arbeit des Internisten haben.
Translationale Forschung dürfe nach Ansicht des DGIM-Vorsitzenden aber nicht ausschließlich national betrachtet werden. Denn Unternehmen richten ihre Aktivitäten heute global aus, auch die deutschen Universitäten müssen sich mehr denn je dem internationalen Wettbewerb stellen und sind zunehmend internationalem Konkurrenzdruck ausgesetzt:
„Dies ist politisch gewollt und spielt auch vermehrt bei der Vergabe von Forschungsgeldern eine Rolle, in jedem Fall auf EU-Ebene“, erläutert Manns. Die Kosten für die Entwicklung eines modernen Medikaments beziffern forschende Pharma-Unternehmen auf ungefähr 800 Millionen Dollar. Translationale EU-Förderprogramme fordern oft die Einbindung von Industriepartnern, die einen Teil der Projektkosten tragen.
Aus der Zusammenarbeit von Industrie und Universitäten können sich allerdings Interessenkonflikte ergeben. Das erfordert Regeln für die Zusammenarbeit. Ein Aspekt ist auch, dass Erfinder zum Beispiel nicht an der klinischen Erprobung ihrer Produkte beteiligt sein sollten, meint Professor Manns.
„Eine zu große emotionale Nähe könnte ein sinnvolles rechtzeitiges Ende eines scheiternden Entwicklungsprozesses verhindern“, befürchtet der Experte. Ebenso wenig sollten Ärzte, die an der Entwicklung neuer Medikamente beteiligt sind oder waren, über den späteren Einsatz an ihren Kliniken mitentscheiden.
Als Präsident des 120. Internistenkongresses stellt Professor Manns damit ein Thema in den Mittelpunkt, das nicht unumstritten ist: „Vorbehalte gegenüber Verquickungen von Forschung und Industrie sind vorhanden und auch nicht völlig unbegründet.“
Doch es wäre geradezu weltfremd, so der DGIM-Vorsitzende, sich dem zu verschließen. Stattdessen seien hier konstruktives Vorgehen und größtmögliche Transparenz notwendig, um vielversprechenden Ansätzen eine Chance zu geben und die Kooperationsmöglichkeiten zu nutzen, ganz im Sinne von „Forschung wird zu Medizin“.
Quelle:
Pressemitteilung
Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM)
Pressestelle Anne-Katrin Döbler, Anna Julia Voormann, Janina Wetzstein